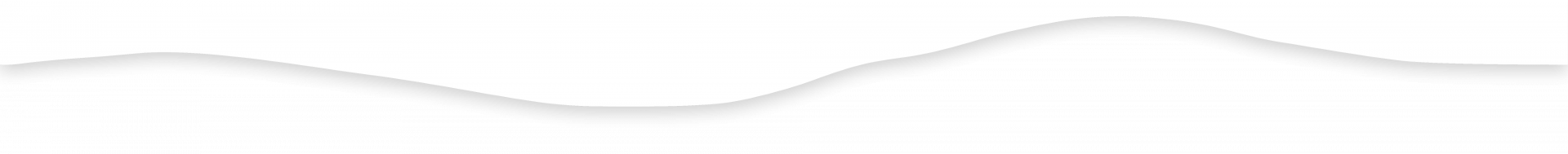Permakultur
Das Konzept der Permakultur wurde in den 1980er Jahren von den beiden Australiern Bill Mollison und David Holmgren entwickelt und ist eine Verbindung der beiden Wörter „permanent“ und „agriculture“, also so etwas wie „dauerhafte Landwirtschaft“.
mehr anzeigen
Die Permakultur lässt sich zwar auf alle Lebensbereiche anwenden, aber wird häufig vor allem mit der Landwirtschaft in Verbindung gebracht. Dabei geht es darum, ressourcenschonend zu wirtschaften, die Natur genau zu beobachten und mit der Natur zu arbeiten statt gegen sie. In der Permakultur ist alles miteinander verbunden und einzelne Elemente werden nicht losgelöst betrachtet.
Ein wichtiges Gestaltungsprinzip der Permakultur und gleichzeitig ein schon Jahrtausende altes Konzept ist der Waldgarten. Durch die Nutzung der verschiedenen Schichten ist Selbstversorgung auf kleinem Raum möglich. In den hochgelegenen Schichten befinden sich die Bäume, darunter Beerensträucher und fruchttragende Büsche und in Bodennähe unterschiedliche Kräuter bis hinab zu den Bodendeckern. In der Humusschicht lassen sich z.B. rhizombildende Gemüse anbauen. Durch eine intelligente Auswahl an kooperierenden Pflanzengesellschaften kann über mehrere Jahre hinweg ein sich tendenziell selbst erhaltender Waldgarten zur Nahrungsversorgung aufgebaut werden. Die ökologische Vielfalt sorgt für Flexibilität und Stabilität.
Langfristig statt kurzfristig
Die Permakultur sieht sich ethisch zur Nachhaltigkeit verpflichtet.
mehr anzeigen
Boden, Wasser und alle anderen lebenserhaltenden Ressourcen sollen so bewirtschaftet werden, dass sie für nachfolgende Generationen bewahrt werden. Jedes Element hat einen Nutzen und eine Funktion im Gesamtsystem und daher wird immer das gesamte System statt einzelner Bestandteile betrachtet. Ein weiterer Aspekt der Langfristigkeit ist die sorgfältige Planung, wie die einzelnen Elemente angeordnet werden, um am besten zusammenzuspielen. Dabei wird der Garten je nach Art der Nutzung und Entfernung vom Wohngebäude in Zonen eingeteilt. Die Elemente, die am meisten Aufmerksamkeit benötigen – wie Tiere und aufwändige Gemüsekulturen – befinden sich in der Nähe des Hauses und andere - wie Obstbäume – am weitesten entfernt.
Vielfalt statt Monokulturen
Die Gestaltung und Bewahrung von Vielfalt ist ein zentrales Anliegen von Permakultur, wobei immer natürlich gewachsene Ökosysteme das Vorbild sind.
mehr anzeigen
Dabei sollen alle Elemente eines Gartens mehrere Funktionen erfüllen. Der Pool ist also Lebensraum für Fische und Wassertiere und dient gleichzeitig der Bewässerung und zum Baden. Enten wiederum legen nicht nur Eier, sondern fressen auch Schnecken und liefern Federn und wertvollen Dünger. Und unsere Esel beweiden den Wald, fressen die invasive Traubenkirsche und schützen gleichzeitig die Schafe und Ziegen. Die Vielfalt zeigt sich auch bei der Auswahl der Gemüsesorten, die nicht wie bei der konventionellen Landwirtschaft einzeln, sondern in Mischkulturen angeordnet sind. So vertreiben beispielsweise Zwiebeln zwischen Mohrrüben die Möhrenfliege und Studentenblumen locken Schnecken vom Gemüse weg. Schädlinge, die sich auf eine Gemüsesorte spezialisiert haben, können weniger zerstören, wenn Kulturen gemischt statt in Monokulturen angebaut werden.
Optimieren statt Maximieren
Um die Erträge zu erhöhen, wird in der Permakultur eher optimiert als vergrößert.
mehr anzeigen
Eine Vergrößerung wäre langfristig gesehen eine Energieverschwendung, denn je höher die genutzte Vielfalt, desto weniger Energie muss in das System hineingesteckt werden. Die Wasserläufe auf dem Rietzer Berg sind ein Beispiel für intelligent genutzte Kleinräumigkeit. Dort sieht man, wie durch die Nutzung verschiedener Dimensionen und Ebenen unterschiedlichem ökologische Nischen entstehen und die benötigte Fläche klein gehalten werden kann. Auch die Begrünung von Dächern und Wänden ist eine Form der Optimierung und guter Ausnutzung vorhandener Flächen.
Kooperation statt Konkurrenz
Um den Garten mit geringstmöglichem Energieaufwand produktiv zu halten, überlassen wir ihn weitgehend sich selbst.
mehr anzeigen
Dazu gehört auch die Nutzung kooperativer Strukturen wie etwa eine biologische Schädlingsregulation. Mit hohem Energieaufwand hergestellte Pestizide vertreiben nicht nur die „Schädlinge”, sondern auch die „Nützlinge”, die uns viel Arbeit abnehmen können. Sobald nämlich die „Schädlinge” wieder einwandern fehlen die „Nützlinge”, weil sie lange keine Nahrung fanden. Nun wird der Schaden erst richtig groß, weil die Population der „Schädlinge” außer Kontrolle gerät, was den neuerlichen Energieaufwand verstärkt. Unsere Tiere sind ein Beispiel für gelebte Kooperation. Die Laufenten-Familie erledigt so manches Schneckenproblem und hält gemeinsam mit den anderen Tieren das Gras kurz. Esel, Damwild, Schafe und Ziegen entfernen die invasive Traubenkirsche, die sich vielerorts ausbreitet. Dadurch können danach wieder heimische Unterholz- und Waldrandgehölze gepflanzt und damit der Wald verjüngt werden.